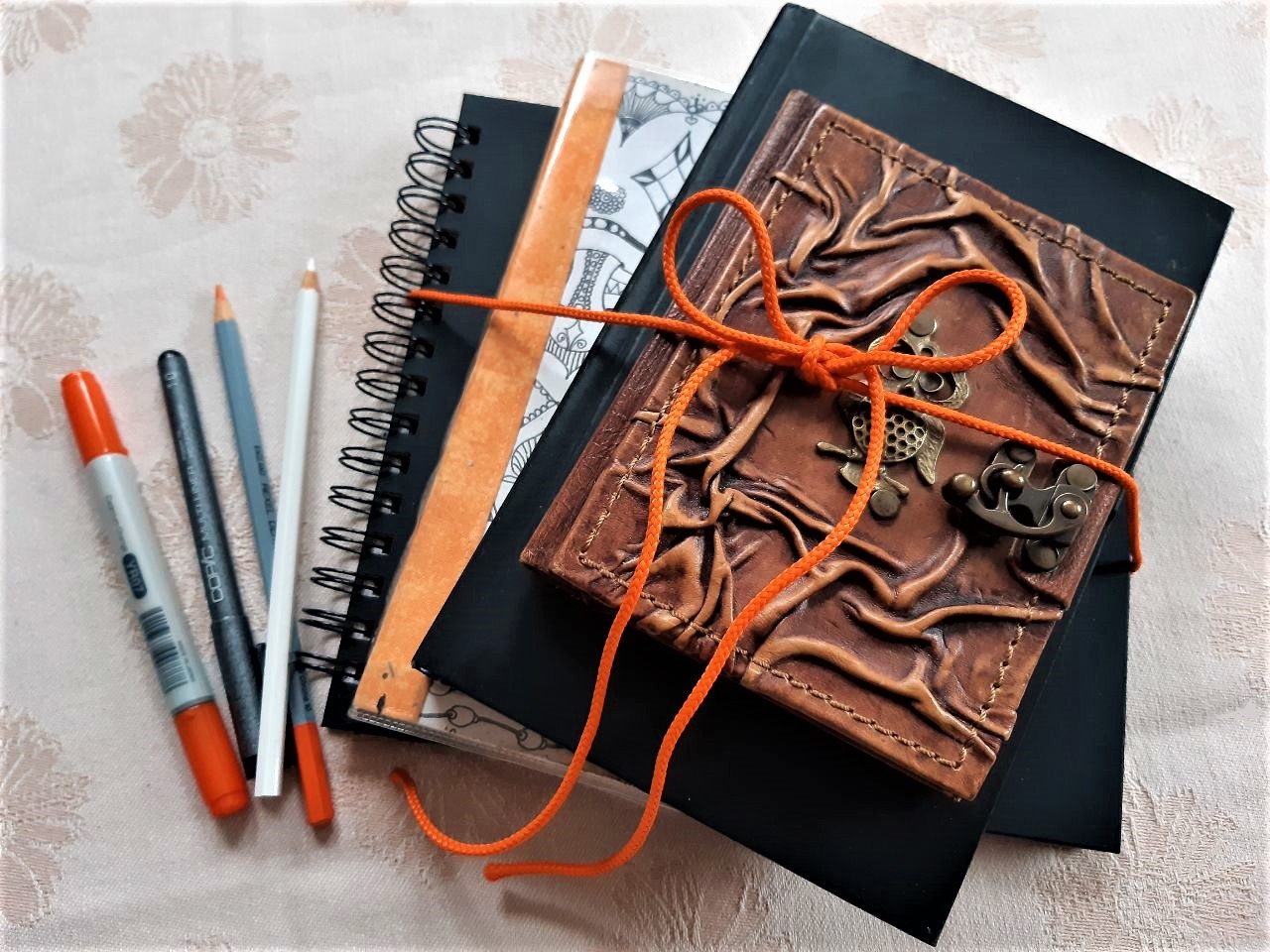Lieber Harz, wir kommen! Nach der traditionellen kurzen Rast im „Hasenwinkel“ (aus dem althd. abgeleitet = Asen-Heiligtum), einem Autobahnrastplatz in der Nähe von Aschersleben, sind es nur noch wenige Kilometer bis zu den geschichtsträchtigen und sagenumwobenen Bergen und Tälern. Hinten am Horizont erheben sie sich schon. Es ist jedesmal eine große Freude, wieder herzukommen.
Diesesmal nehme ich Dich mit zu einer Trockenmauer mitten im Wald am Hang, zu den Spuren einer alten Königspfalz und auch wieder zu einer wunderschönen frühromanischen Klosterkirche. Und wir durchwandern ein Tal, das aussieht wie ein Park, von Gott geschaffen. Zum Abschluß empfehle ich Dir einen Platz zum Rasten mit dem besten Kaffee und Bodeblick.
Die Trockenmauer im Bodetal
Wir laufen auf dem Hexenstieg durch das wilde Bodetal. Ich habe den Eindruck, daß es von Besuch zu Besuch immer wilder wird. Ich weiß nicht, ob man mit dem Aufräumen nicht hinterherkommt oder es mit Absicht sich selbst überlassen bleibt – jedenfalls ist es urwüchsig und wildromantisch. Es gibt Photomotive ohne Ende, und das Wandern geht nur langsam voran, weil das Auge schweift und sich nicht sattsehen kann!
Wir sind hier mitten im Wald, links fließt die Bode, rechts von uns sieht man die Schieferfelsen. Oben am Hang – ich dachte erst, ich habe mich verguckt und es ist einfach ein Stück des Schieferfelsens – sehe ich plötzlich eine Art Mauer zwischen den Bäumen. Natürlich bin ich hochgeklettert und es gelang mir, einige Aufnahmen davon zu machen. Sie zieht sich – mal höher, mal niedriger – viele Meter oben am Hang entlang.
Die Mauer ist sehr sorgfältig aus flachen Schiefersteinen geschichtet. Es wirkt, als gibt es ältere und neuere Mauerabschnitte. Im Laufe der Zeit sind Teile sehr verwittert bzw. weggebrochen. Dahinter bzw. darüber ist nichts außer Wald. Ob das der Rest eines alten Bauwerkes bzw. eines ehemals bebauten Areals ist? Sehr rätselhaft!
Die Königspfalz Bodfeld
Die Pfalzen waren Aufenthaltsorte von deutschen Königen und Kaisern, die im frühen Mittelalter nicht von einer Hauptstadt aus regierten, sondern mit Familie und Gefolge ständig im Land unterwegs waren. Auf den Pfalzen erledigten sie Verwaltungsgeschäfte und Aufsichtsaufgaben. Die Pfalzen im Harz dienten auch zu Jagdaufenthalten.
Mit einer eher vagen Wegbeschreibung zogen wir los in den Wald in der Nähe von Elbingerode. Wir liefen über ein gerodetes, jetzt eher niedrig bewachsenes Hochplateau in der Hoffnung, auf dem richtigen Weg zu sein. Dann tauchte wie eine Insel im Buschwerk in der Ferne das Wäldchen auf (siehe Photo), und intuitiv dachte ich – dort muß es sein. Was auf dem Photo nicht zu sehen ist, zwischen uns und dem Wäldchen liegt ein tiefes, steil eingeschnittenes Tal. Das Wäldchen ist nur von rechts aus südlicher Richtung begehbar und liegt auf einem Felsensporn, der auf allen anderen Seiten von tiefen Felseinschnitten umgeben ist.
- Informationstafel an der ehemaligen Pfalz
Der Felsensporn wird Schloßkopf genannt. Vielleicht stammt dieser Name aus der Zeit, als die Adeligen sich hier aufhielten. Das Plateau auf dem weit herausragenden Sporn wurde von Menschenhand geschaffen. Vorn auf dem Felsen lag eine burgartige Befestigungsanlage, das Areal selbst war weit größer, beherbergte Wohnhäuser und Gewerbebetriebe. Hier im Harz wurde schon seit 300 v.Ch. Erz abgebaut. Sicher wurde von der Pfalz aus auch die damals wirtschaftlich wichtige Erzgewinnung kontrolliert, die mit dem frühen Mittelalter an Fahrt aufnahm.
Mit seiner „Ersterwähnung“ von 935 ist es eine der älstesten nachgewiesenen Siedlungen im Harz. (1) Die Pfalz wurde von mehreren deutschen Königen und Kaisern für Aufenthalte genutzt. Der Salier-Kaiser Heinrich III. starb hier 1056, und sein Sohn, Heinrich IV., wurde hier zum deutschen König ernannt. Die schriftlichen Urkunden sind das eine. Was wir nicht wissen, was hier vorher schon geschehen war, wer hier gesiedelt hatte, als das alles noch nicht aufgeschrieben wurde. Es ist eine sehr übersichtliche und vorteilhafte Lage auf dem Felsensporn inmitten des damals wilden, unerschlossenen Gebirges, das dürfte auch früheren Siedlern nicht entgangen sein. Es muß nicht sein – ich möchte Dich nur darauf hinweisen, daß die vielgenannten Urkunden lediglich die Situation ab der Verschriftlichung beschreiben. Das muß nicht der Anfang der Geschichte sein.
Vom ursprünglichen Baumaterial sind heute kaum Überreste vorhanden. Und auch das Wissen um die Existenz der Jagdpfalz versandete, nachdem sie ab dem späten 11. Jh. nicht mehr benutzt wurde.
1885 wurden hier Ausgrabungen durchgeführt und die Lage von Gebäuden festgestellt. Erst in heutiger Zeit ist man jedoch sicher, hier die Pfalz Bodfeld zu sehen. Die Umrisse der Bauten werden durch Steinschüttungen nachgebildet. Vielleicht ist das eine oder andere Fundamentfragment noch zu sehen. An der Stelle, wo die ehemalige Burgkapelle vermutet wird, steht heute ein Holzkreuz.
Ich finde eher den Ort als solches interessant, weniger, daß er auch zu einer bestimmten Zeit als Königspfalz diente. Es ist ja so, daß dieselben Orte durch die Zeitenläufte hindurch immer wieder benutzt wurden, sei es aufgrund ihrer vorteilhaften Lage oder weil sie eine besondere Atmosphäre oder Energie ausstrahlten. Oder weil von deren Position aus bestimmte astronomische Konstellationen gut beobachtbar waren. Schade ist eben, daß bei der Nutzung dieser Orte durch die Menschen der nächstfolgenden Epoche die Spuren der vorhergehenden zerstört werden.
Bei Forschungen und Ausgrabungen werden allenfalls noch Bruchstücke, Fundament- oder Mauerreste, rätselhafte Gravuren und Ritzungen in Steinen o.ä. gefunden, oft in ihrer Funktion nicht mehr zuordenbar. Und aus welcher Zeit sie stammen, darüber können wir nur rätseln. Wie weit können wir eigentlich zurückschauen? Welche Rätsel werden für immer verborgen bleiben?
Kloster Drübeck in Ilsenburg

Klosterkirche St. Vitus, bemerkenswert: am ganzen Gebäude kein Kreuz.
Geschichte: Der Sage nach ist Drübeck eine sehr frühe Klostergründung – entstanden bereits im 9. Jh. unter der Herrschaft des Ostfrankenköniges Ludwigs III. unter der Leitung der ersten Äbtissin Adelbrin. „Der Sage nach“ bedeutet ja, es wurde gesagt und mündlich weitergegeben. Die „Sage“ ist für die Wissenschaft eine unzuverlässige Quelle, deshalb beruft man sich auf die erste „Urkunde“ zu dem Thema, die eine Schenkung Ottos I. an das Benediktinerinnenkloster im Jahr 960 dokumentiert. (2)
Das Kloster Drübeck in Drübeck bei Ilsenburg am Nordrand des Harzes liegt an der Straße der Romanik. Die Gebäude und Gärten blicken auf eine lange, mehr als 1000jährige Geschichte zurück. Die ganze Klosteranlage präsentiert sich in heutiger Zeit sehr hübsch und liebevoll gepflegt, wiederhergestellt nach wechselvoller Geschichte und wird auf vielfältige Weise genutzt.
- die 300-jährige Klosterlinde
Der Name: Der überlieferte Name lautet – je nach Quelle – Dri Beke oder Drubechi – vielleicht mundartliche Verschiebungen im Laufe der Zeit. Neben dem Suchen nach ursprünglichen altdeutschen Wortstämmen und deren altem Sinn ist es auch von Bedeutung, die vor Ort alteingesessenen Dialekte zu beachten. Wie ich von Herrn Werner Körner, ein Leben lang ansässig und forschend im Nordharz, lernte, wurde (und wird) am Harznordrand Platt gesprochen, offiziell die Ostfälische Bodemundart. Er sagt: dat Beck = der Bach. ein dröhes Beck = ein trockener Bach. So wird dort heute noch gesprochen. Das Kloster wurde von kleinen Bächen aus dem Nordharz versorgt, die ganz unterschiedlich Wasser aus den verschiedenen Harztälern führten, mal mehr und mal weniger. Vielleicht hat das Kloster daher seinen Namen, zumindest im Volksmund?
Doch denkst Du, daß ein Heiliger Ort – mit großer Gewißheit schon lange vor der Existenz des Christentums und des Klosters – nach einem manchmal trockenen Bach benannt worden wäre? Wird dieser Name der Bestimmung eines solchen Ortes gerecht?
Die Vorsilbe dru steht in einer Bedeutungsfamilie mit dre, tre, tri, thri, tro und bedeutet in der Ursprache Drehen, durch Drehung schaffen, das „mittels Drehen und Wenden sich Verändernde“. Gemeint ist die Dreh- bzw. ständige Weiterentwicklungskraft der Dreieinheit von Werden, Sein und Vergehen, wunderbar symbolisiert in der drehenden Triskele. Die Silbe findet sich auch in Trude („Die Regentrude“), Druide, Dreher (=Priester).
bech – bek = Gericht -> Hinweis auf einen alten Gerichtsort (3)
So könnte der Ort ein alter Gerichts- und Versammlungsplatz sein: „Das Gericht, das durch die Kraft seiner weisen Entscheidungen die Weiterentwicklung der Gemeinschaft schafft und fördert“.
Die Klosterkirche St. Vitus ist ein in seinen Anfängen früh- oder sogar vorromanischer Bau in Form einer flachgedeckten dreischiffigen Basilika mit einfachem Stützenwechsel Pfeiler – Säule – Pfeiler. Das gewaltige Westwerk kam erst später hinzu. Sie wurde um 1000 gebaut, jedoch war sie wahrscheinlich ihrerseits bereits der Nachfolgebau oder Umbau eines Heiligen Hauses, dessen Spuren bereits verwischt sind. Beim Anblick schon von außen spürst Du ihre alte Ausstrahlung. Sie steht so gewaltig und majestätisch da, daß Du gar nicht spürst, daß ihr eigentlich ein wichtiger Teil fehlt, nämlich das nördliche Seitenschiff und der nördliche Arm des Querhauses. Diese wurden im „Bauernkrieg“ und durch Brandschatzung zerstört. Große Teile (Mittelschiffwände, Krypta, die fünf Säulen mit ottonischen Kapitellen, der Südarm des Querhauses, das Westwerk mit Apsis) sind noch echte alte Bausubstanz (4). Es gibt auch einen erst vor kurzem freigelegten alten Fundamentzug nördlich neben der Kirche, der einem Vorgängerbau zugerechnet wird.
- lauschige Eingangsallee zum Kloster
- die mächtigen Westtürme mit einem Klostergebäude davor
- große Ähnlichkeit zur Stiftskirche in Gernrode
Manche sagen, die alten Heiligen Bauten waren Häuser der Zusammenkunft und des Gesanges unserer Altvorderen bereits lange vor der Christianisierung. Sie hatten keine Türme. Wenn es heißt, die früheste Nachricht über den Bau stamme von 1004, bedeutet das ja nur, daß mit der Verschriftlichung solche Dinge von den Beamten, Schreibern o.ä. ab diesem Zeitpunkt festgehalten wurden. Es sagt nichts darüber aus, wann der Bau tatsächlich entstand.
- Blick ins südliche Seitenschiff, an der Wand wurden im 12. Jh. Wandvorlagen für die Einwölbung des Mittelschiffes angebracht
- Kapitell aus der Anfangszeit mit bärtigen Männerköpfen
- Blick nach Westen, rechts fehlt das nördliche Seitenschiff
- ein wunderschöner harmonischer Raum, zur Vierung und zum Westchor optisch von einem Rundbogen getrennt
- altes Kapitell, toll die ausgeprägte Ornamentik in Spiralenform unten an der Kämpferplatte
- Blick vom Seitenschiff Richtung Westen, der Stützenwechsel ist schön zu sehen
Die mächtigen Türme des Westwerkes, worin auch die Glockenstühle sind, wurden erst im 12. Jh. gebaut. Ab wann nutzte man eigentlich Glocken in sakralen Bauten und wofür? Zum Zusammenrufen der Gemeinschaft? Zur Einteilung der Zeit? Als Benachrichtigungsinstrument bei wichtigen Ereignissen? Als wahrscheinlich viel älteres Signalinstrument ist aus der Zeit unserer Altvorderen die Hillebille bekannt – ein mobiles oder stationär aufgehängtes Holzbrett, auf das in einem bestimmten Rhythmus mit einem Holzstock eingeschlagen wurde. Der Klang mit der Nachricht verbreitete sich durch die Wälder und Felder von einem Hof zum nächsten.
Bekommst Du auch ein ganz eigentümlich anrührendes Gefühl beim Klang besonders der großen majestätischen Haupt-Glocken? Einerseits feierlich, erhebend und ernst, andererseits geborgen und mit einem unbestimmten Gefühl der Erinnerung?
Die Glocke hat eine lange Geschichte vom Glöckchen am Saum eines Priestergewandes über die Handglocke eines Missionars bishin zu großen, stationär aufgehängten Glocken, die mit Seilen geläutet wurden. „Spätestens im 6. Jh. war die Glocke von einem Unheil abwehrenden Amulett zu einer Läuteglocke der christlichen Kultur übergegangen, ohne jedoch ihre übernatürliche Kraft verloren zu haben“, steht bei Wikipedia. Das Christentum hat sich sozusagen die alten magischen Eigenschaften der Glocke zu eigen gemacht und sie umgedeutet. Was spüre ich da also beim Hören eines Glockengeläutes – vielleicht wird ja auch eine viel ältere Saite meiner Erinnerung angeschlagen?
Die große schwere Glocke von St. Vitus, die Benedicta getauft wurde, ist 1449 gegossen worden. Sie ist sehr alt und historisch wertvoll und ist deshalb den großen Glockeneinschmelzungen der beiden Weltkriege zum Glück entgangen.
Nach der Reformation fiel das Klosterareal in weltliche Hände – an die Grafen von Stolberg-Wernigerode. Sie erneuerten die Konvent- und Wirtschaftsgebäude des Klosters. Es wurde ein Damenstift eingerichtet. Aus dem Jahr 1737 ist ein Gartenplan erhalten, der die besonderen Gärten der Stiftsdamen zeigt, die jeweils von Mauern umschlossen waren. Diese kleinen romantischen Gärten sind auch heute noch zu besichtigen.
- Taufstein aus der Anfangszeit
- die Krypta stammt aus der ersten Bauphase
- Kapitell in der Krypta mit Tieren
- 1000-Jahr-Feier
1877 im Zuge der Vorbereitung der 1000-Jahr-Feier des Klosters ging eine umfangreiche bauliche Sanierung zu Ende, die dem Kunstsinn des regierenden Grafen Otto zu verdanken war.
Ab 1946 übernahm das Diakonische Amt der Kirchenprovinz Sachsen das Kloster. So blieb das Kloster zu DDR-Zeiten quasi unter dem Schutz der Kirche und konnte weiterhin wohltätig wirken. Es entstand ein Kurheim. Mit Hilfe finanzieller Mittel des Diakonischen Amtes wurden in den 1950er Jahren barocke Umbauten zurückgebaut, die Kirche sollte wieder das Aussehen des Originalbaues erhalten. So können wir sie heute in ihrer alten reinen und harmonischen Ausstrahlung erleben.
Wenn wir heute diesen schönen Ort besuchen, uns von seiner Atmosphäre einfangen lassen, seine Energie erspüren, so ehren wir ihn in seiner ganzen Existenz, auch wenn wir seine ganze Vergangenheit nicht erfassen können. Solange wir diese Plätze haben, können wir uns immer mit unseren Wurzeln, unseren Altvorderen verbinden.
Wanderung durch „Gottes Garten“ – das Selketal in Bildern

Licht und Schatten auf dem Wasser

ein Baumkreis
- ein Feld voll Herbstzeitlose
- Baumfreund
- sonniger Frühherbst
- wunderbarer Wanderweg durch das Tal
Zum Schluß ein fröhliches und zugleich seltenes Detail in Treseburg an der Bode und eine unkonventionelle Pensions-Empfehlung
Die Pension Sternschnuppe mit Biergarten direkt am Wasser, Kesselgulasch und Feuerstelle liegt auf dem Ufer der Bode, das nur per Fußgängerbrücke oder Furt erreichbar ist. Dort gibt es an der Sommerküche zu jeder Zeit einen richtig guten Kaffee. Der Wirt ist sehr sympathisch! :)
- An der Feuerstelle mit Sitzgelegenheiten rundherum läßt es sich gemütlich sitzen und klönen
- Vorn der Fluß und hinten Wald – Ruhe und Natur pur! Hier kann die Seele baumeln :)
( Übrigens beruhen alle gastronomischen Empfehlungen in meinem Blog auf freundschaftlicher Verbundenheit oder meiner eigenen Begeisterung für den Ort und sind mit keinerlei finanziellem oder anderweitigem Vorteil verbunden – es sind einfach Wohlfühl-Orte, die ich Dir von ganzem Herzen gern weiterempfehle! )
Eine inspirierende Reise geht zu Ende – die Momente in den Wäldern, die frische und reine Luft, die Bäche und Flüsse und die Menschen, denen wir begegnet sind, sind jedoch unvergessen. Und die nächsten Reiseziele im Harz sind schon in Vorbereitung!
Quellen und Inspiration:
Wikipedia: Oberharzer Bergbau, Glocke, Kirchenglocke, Drübeck, Kloster Drübeck
(1) Harzlife über die Pfalz Bodfeld: https://www.harzlife.de/special/pfalz-bodfeld.html
(2) Harzlife über Kloster Drübeck: https://www.harzlife.de/harzrand/kloster-druebeck.html
(3) Rainer Schulz: „Die wahre Bedeutung der deutschen Ortsnamen“, Hagal-Verlag, 4. Auflage, ab S. 471
(4) Deutsche Stiftung Denkmalschutz: https://www.denkmalschutz.de/denkmal/ehem-klosterkirche-st-vitus.html
Netzseite des Kloster Drübeck: https://kloster-druebeck.de/geschichte/
Netzseite der Pension Sternschnuppe: https://www.pension-sternschnuppe.de/